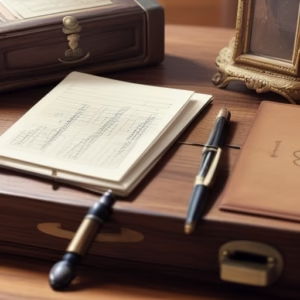In Deutschland ist die Erbfolge ein zentrales Thema, das viele Unsicherheiten mit sich bringt, insbesondere für Ehepartner. Wie sicher sind Ihre Erbansprüche? Was passiert mit dem Nachlass, wenn Sie keine eindeutigen Regelungen getroffen haben? In unserem Artikel erfahren Sie alles über die gesetzliche Erbfolge, das Berliner Testament und die gegenseitige Alleinerbschaft. Entdecken Sie, wie Sie die Ansprüche Ihres Partners schützen und Konflikte vermeiden können – für eine sorgenfreie Nachlassregelung.
Gesetzliche Erbfolge in Deutschland
Die gesetzlichen Erben ergeben sich aus der gesetzlichen Erbfolge, einem zentralen Element des deutschen Erbrechts. Sie greift immer dann, wenn für den Nachlass keine anderen Regelungen, etwa durch ein Testament oder einen Erbvertrag, getroffen wurden.
Der überlebende Ehegatte als gesetzlicher Erbe
Der überlebende Ehegatte ist gemäß § 1931 BGB gesetzlicher Erbe. Ohne Testament oder Erbvertrag ist er jedoch selten alleiniger Erbe: Seine Erbquote wird häufig durch weitere gesetzliche Erben, wie Kinder oder Eltern des Erblassers, beeinflusst.
Sind keine Kinder des Erblassers vorhanden oder sind alle Kinder vorverstorben, ohne eigene Abkömmlinge zu hinterlassen, treten die Eltern des Erblassers als gesetzliche Erben zweiter Ordnung neben dem überlebenden Ehegatten. In diesem Fall beträgt der Anteil des Ehegatten mindestens die Hälfte des Nachlasses; die andere Hälfte geht an die Eltern des Erblassers.
Dadurch wird sichergestellt, dass neben dem Ehegatten auch andere direkte Verwandte berücksichtigt werden und eine gerechte Erbaufteilung erfolgt.
Erbfall mit Kindern des Erblassers
Im Erbfall, wenn Kinder des Erblassers vorhanden sind, erhöht sich der gesetzliche Erbteil des überlebenden Ehegatten in der Zugewinngemeinschaft um ein Viertel des Nachlasses.
- Dieses Szenario bleibt auch dann relevant, wenn die Kinder des Erblassers bereits vorverstorben sind.
- Solange noch Abkömmlinge (Enkel, Urenkel) als gesetzliche Erben erster Ordnung vorhanden sind, treten diese gegebenenfalls an die Stelle der vorverstorbenen Kinder des Erblassers.
Anspruch auf Voraus
Neben dem gesetzlichen Erbteil hat der Ehegatte gemäß § 1932 BGB einen Anspruch auf den sogenannten Voraus. Zum Voraus zählen:
- Gemeinsame Haushaltsgegenstände
- Das von beiden Eheleuten genutzte Auto
Persönliche Gegenstände des Erblassers, wie Kleidung und Schmuck, sind vom Voraus ausgenommen. Art und Umfang des Voraus richten sich unter anderem danach, ob der Ehegatte Kinder oder andere nahe Verwandte hinterlässt.
Ausschlagung der Erbschaft
Wenn ein gesetzlicher Erbe die Erbschaft ausschlägt, fällt sein Anteil an diejenigen, die im Falle des vorherigen Versterbens des Ausschlagenden geerbt hätten.
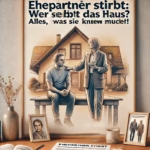
Erfahren Sie, was passiert, wenn der Ehepartner stirbt und wer das Haus erbt. Holen Sie sich die wichtigen Informationen zu Erbrecht…
Das Berliner Testament im Detail
Das Berliner Testament ist ein gemeinschaftliches Testament von Ehegatten, das regelt, wie das Vermögen nach dem Tod eines der Ehegatten verteilt wird. Bei dieser Form des Testaments ist der überlebende Ehegatte zunächst Alleinerbe des verstorbenen Ehegatten; die Kinder gehen in der ersten Erbfolge zunächst leer aus und erhalten das Erbe erst nach dem Tod des zuletzt versterbenden Elternteils. Dadurch soll die finanzielle Absicherung des überlebenden Ehegatten gewährleistet werden.
Steuerliche Aspekte
Ein zentraler Aspekt des Berliner Testaments sind die steuerlichen Auswirkungen. Überschreitet das vererbte Vermögen die Freibeträge, wird Erbschaftsteuer fällig. In der Regel beträgt der Freibetrag für Kinder jeweils 400.000 Euro pro Kind und Elternteil.
Da die Kinder beim Berliner Testament jedoch erst im zweiten Erbgang erben, werden die Freibeträge beim Tod des zuerst versterbenden Elternteils nicht in Anspruch genommen. Dies kann dazu führen, dass das gesamte elterliche Vermögen bei Eintritt der Erbschaft des zuletzt versterbenden Elternteils auf einmal besteuert wird. Dadurch erhöht sich die steuerliche Belastung erheblich. Die Kinder verlieren praktisch einen Freibetrag, da sie nicht getrennt von beiden Elternteilen erben können.
Schlusserben und Erbfolge
Um die Erbfolge gezielt zu steuern, werden im Berliner Testament häufig sogenannte Schlusserben benannt. Durch diese ausdrückliche Benennung werden die zunächst enterbten Angehörigen wieder erbberechtigt, wenn beide Ehegatten verstorben sind. Auf diese Weise gelangen die Kinder erst nach dem Tod beider Elternteile an ihr Erbe.
Ein weiteres Merkmal ist die Bindungswirkung nach dem Tod eines Ehegatten: Das Testament kann nach dem ersten Erbfall nicht mehr einseitig geändert werden. Dies erfordert eine sorgfältige Planung und eine klare Absprache der Wünsche beider Ehegatten bereits zu Lebzeiten.
Vorteile des Berliner Testaments
In Situationen, in denen ansonsten eine Erbengemeinschaft entstehen würde, kann das Berliner Testament Vorteile bringen. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn der gesamte Nachlass beim überlebenden Ehegatten verbleiben soll.
- Verhindert den sofortigen Verkauf eines gemeinsamen Hauses.
- Der überlebende Ehegatte behält die Entscheidungsfreiheit über das Vermögen.
- Keine Zustimmung Dritter erforderlich.
Für kinderlose Ehegatten ist das Berliner Testament ebenfalls oft relevant: Ohne eine solche Verfügung, wie ein Testament Ehepartner Alleinerbe ohne Kinder, würden nach dem Tod eines Ehegatten andere Verwandte wie Geschwister, Nichten oder Neffen erben. Durch die gegenseitige Einsetzung als Alleinerben bleibt das Vermögen beim überlebenden Ehegatten.
Klauseln und Regelungen
Bei der Gestaltung des Berliner Testaments sind zudem Klauseln zu berücksichtigen, wie etwa die Wiederverheiratungsklausel. Diese besagt oft, dass der überlebende Ehegatte im Fall einer erneuten Heirat nur die Hälfte des Erbes erhält, während der verbleibende Teil der gesetzlichen Erbfolge zufällt.
Ebenso finden sich Pflichtteilsstrafklauseln, die verhindern sollen, dass Kinder ihren Pflichtteil bereits vor dem Tod des zuletzt versterbenden Elternteils einfordern und sich damit de facto selbst enterben würden. Solche Regelungen thematisieren auch die Situation, ob ein Alleinerbe den Pflichtteil auszahlen muss. Eine präzise Formulierung im Testament des Alleinerben und in der Regel eine notarielle Beurkundung sind erforderlich, damit die Verfügungen rechtlich wirksam sind.
Gegenseitige Alleinerbschaft im Berliner Testament
Das Berliner Testament ist ein gemeinsames Testament von Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartnern, in dem beide ihre letztwilligen Verfügungen gemeinsam niederlegen. Es ist typisch für die gegenseitige Erbeinsetzung: Stirbt ein Ehegatte, erbt der überlebende Ehegatte zunächst das gesamte Vermögen.
Erst mit dem Tod des zuletzt Verstorbenen greifen die Regelungen für die Folgerben, oft die gemeinsamen Kinder.
Vorteile des Berliner Testaments
Mit dieser Konstruktion soll das Vermögen innerhalb der Familie zusammenbleiben und dem überlebenden Ehegatten finanzielle Sicherheit bieten. Die Kinder haben bis zum Tod des Letztversterbenden keinen Anspruch auf ihren Erbteil; ihre Zuteilung erfolgt erst in der zweiten Erbphase.
- Finanzielle Sicherheit für den überlebenden Ehegatten
- Schutz des Vermögens innerhalb der Familie
- Gestaltungsmöglichkeiten für die Erbfolge
Befreites Alleinerbe
Eine spezielle Ausgestaltung ist das sogenannte befreite Alleinerbe: Der überlebende Ehegatte erhält zwar Zugriff auf das Vermögen, ist jedoch verpflichtet, dieses nach seinem Tod entsprechend den testamentarischen Vorgaben an die benannten Erben weiterzugeben.
Damit wird verhindert, dass das Vermögen etwa durch eine neue Ehe des Überlebenden in fremde Hände gerät.
Formvorschriften und Rechtsgültigkeit
Bei der Errichtung sind gewisse Formvorschriften zu beachten. Das Testament können die Ehegatten selbst handschriftlich oder mithilfe einer Testament Ehepartner Alleinerbe Vorlage erstellen.
Für die Rechtsgültigkeit muss mindestens einer der Ehegatten den Text handschriftlich verfassen und beide den Inhalt unterschreiben.
Notarielle Beurkundung
Eine notarielle Beurkundung schafft zusätzliche Rechtssicherheit; ein notarielles Testament wird zudem im zentralen Testamentsregister hinterlegt.
Steuerliche Aspekte
Auch steuerliche Aspekte spielen eine Rolle: Mit einem Berliner Testament lassen sich Freibeträge nutzen, die Erbschaften für den überlebenden Ehegatten und die Kinder steuerlich entlasten.
| Beziehung | Freibetrag |
|---|---|
| Ehegatten | 500.000 Euro |
| Kinder | 400.000 Euro |
Rechtliche Klarheit
Unklare Formulierungen können zu rechtlichen Streitigkeiten führen; daher sind eindeutige und präzise Formulierungen für ein Testament als Alleinerbe wichtig, um den Willen der Erblasser klar zu dokumentieren.
Während der Ehe kann das gemeinschaftliche Berliner Testament nicht einseitig aufgehoben werden; nach dem Tod eines Ehegatten bleibt es in seiner ursprünglich festgelegten Form bestehen.

Erbschaft in der Ehe: Welche Regelungen beachten? ️ Erfahren Sie, wie Sie Vermögen optimal schützen und gestalten. Klicken Sie für…
Häufig gestellte Fragen zu Ehepartnern als Alleinerben
Kann man sich gegenseitig als Alleinerben einsetzen?
Ja, Ehegatten können sich gegenseitig als Alleinerben einsetzen. Dies geschieht häufig im Rahmen eines sogenannten Berliner Testaments, welches von Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartnern erstellt wird. In diesem Testament wird sichergestellt, dass der überlebende Ehegatte den gesamten Nachlass erhält. Zudem sollten Schlusserben, wie gemeinsame Kinder, benannt werden, um die Verteilung des Vermögens nach dem Tod des zuletzt versterbenden Partners zu regeln.
Was passiert, wenn der Partner stirbt und man nicht verheiratet ist?
In Deutschland haben unverheiratete Paare kein gesetzliches Erbrecht im Todesfall. Das bedeutet, dass der Partner in einer eheähnlichen Beziehung ohne offizielle Eheschließung im Erbfall rechtlich nicht geschützt ist. Um den Partner abzusichern, ist es ratsam, ein Testament zu erstellen, eine Lebensversicherung abzuschließen oder ein Vermächtnis für den Partner zu hinterlassen.
Wie kann man die Ehefrau im Erbrecht absichern?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um die Ehefrau im Rahmen des Erbrechts abzusichern, darunter das Testament, der Erbvertrag und Schenkungen. Jedes dieser Instrumente hat seine eigenen Vor- und Nachteile. Es ist wichtig, sich vor der Entscheidung über die geeignete Methode Gedanken zu machen und gegebenenfalls rechtlichen Rat einzuholen, um eine optimale Absicherung zu gewährleisten.
Kann ein Ehepartner ein Testament allein erstellen?
Ja, jeder Ehegatte kann ein Einzeltestament erstellen. In diesem Testament kann der andere Ehegatte als Erbe eingesetzt werden, muss dies jedoch nicht geschehen. Es ist auch möglich, dass der Ehegatte anordnet, dass stattdessen die Kinder, enge Freunde oder sogar wohltätige Organisationen, wie zum Beispiel die katholische Kirche, Erben werden.
Weitere verwandte Artikel, die Sie interessieren könnten