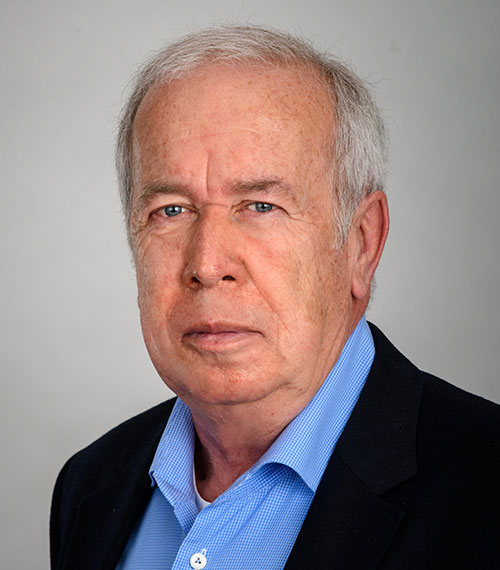Wolfram O. Voegele
Rechtsanwalt
Arbeitsbereich: Deutsches und Internationales Erbrecht, Stiftungsrecht
Zulassung als Rechtsanwalt 1981
Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Freiburg
Sprachen
Deutsch, Englisch, Französisch
E‑Mail – voegele@lexis-rechtsanwaelte.de
Tel. (030)/319 815 11 1